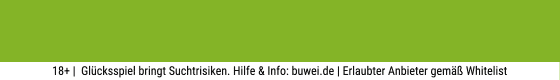Warum heißt ein Pferd Love Academy, Mystic Lips, Saldentigerin (Foto) oder Migräne? Wer bestimmt darüber, ob eine zauberhafte Pferdelady, Inbegriff von Ästhetik und Charme, für ihre Renn- und Zuchtlaufbahn ihr Leben lang als „Ipanema“, „Kockpitt“ oder „Evil Empire“ (Reich des Bösen) herumläuft? Meistens übt dieses Recht der „Züchter“ aus, also der Besitzer der Mutter des Fohlens zum Zeitpunkt der Geburt. Er kann diese Gestaltungsaufgabe – lästige Pflicht oder intellektuelle Herausforderung – bei einer Veräußerung des jungen Pferdes aber auch dem Käufer überlassen. So lange sind noch namenlose Pferde als „N. N.“ (lateinisch für nomen nominandum – der Name ist noch zu nennen) unterwegs.
Spätestens, wenn ihre Rennlaufbahn näher rückt, geht aber nichts mehr ohne praktikable namentliche Unterscheidbarkeit. Deshalb können auch nicht Dutzende von Fohlen „Heidi“ oder „Beauty“ heißen, denn dann wären – jedenfalls in der Praxis – unverwechselbare Identitäten und Abstammungsnachweise, funktionierender Renn- und Wettbetrieb sowie eine sinnvolle Zuchtplanung weltweit Illusion.
Deshalb gilt im Kosmos der Vollblutzucht schon seit langer Zeit: Jeder Name darf in einem gewissen Zeitraum und in einem Land nur einmal vorkommen. Durch den Zusatz von Geburtsjahr und Länderkennung (GER für Deutschland) ist jedes Pferd somit rund um den Globus eindeutig zu identifizieren.
Das ist von größter systematischer Bedeutung. Um die Einzigartigkeit der Namen zu gewährleisten, erfährt die Kreativität bei der Taufe so manche Einschränkung durch die geltenden Regeln. Oft ist der im Familienrat des Züchters mühevoll herausgefilterte ultimative Wunschname für ein Fohlen schon vergeben, der zweitliebste ebenso – und so weiter, bis zur Verzweiflung.
So ist es immer wieder schon zu nicht ganz so lichtvollen Kompromissen gekommen – am meisten in der großen Zucht der USA, wo das Verzeichnis der blockierten Namen ähnlich dick ist wie das Telefonbuch einer deutschen Großstadt. Außerdem haben die Menschen nun einmal recht unterschiedliche Vorstellungen, der Zeitgeschmack kommt noch hinzu. So nennt der eine seine vierbeinige Hoffnungsträgerin „Princess Eboli“ und der andere „Waschfrau“. Beide Stuten haben den Preis der Diana gewonnen – die eine 1976, die andere 1895 – und damit bewiesen, dass Namen nicht das allein Ausschlaggebende sind.
Obwohl es prominente Experten wie den großen Heinz Jentzsch gibt, die gegen Pferde mit „verrückten“ Namen ausdauernde Vorbehalte haben. Rund 1200 Vollblutfohlen werden in Deutschland pro Jahr geboren. Bei einer solchen Zahl ist es nicht so einfach, für jedes einzelne Fohlen einen passenden, schönen Namen zu finden, der gleichzeitig auch noch den Erfordernissen der Rennordung entspricht. Nach dieser muss der Fohlenname keineswegs nur denselben Anfangsbuchstaben haben wie den der Mutter.
Er darf außerdem nicht mehr als 18 Anschläge haben, nicht gegen die guten Sitten verstoßen, nicht bloß aus aneinandergereihten Großbuchstaben – etwa CIA – bestehen. Er muss gut auszusprechen sein, unverwechselbar und geschlechtstypisch. Und aus züchterischen Erwägungen kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu: Der Name darf nicht in den letzten 20 Jahren für andere, zur Zeit noch lebende Pferde registriert worden sein und auch nicht für Pferde, die im laufenden Gestütbuch als Mütter oder Großmütter aktiver Pferde aufgeführt sind.
Schließlich und endlich darf es nicht der Name eines in- oder ausländischen Pferdes sein, das so bedeutend war oder ist, dass sein Name auch international für alle Zukunft gesperrt wurde. So wird verhindert oder zumindest wirkungsvoll eingeschränkt, dass bei der Ahnenforschung Verwechslungen auftreten, die den Züchter irreführen können.
Das Ergebnis sieht allerdings so aus, dass es in Deutschland schon Namen gab wie „Frustration“, „Letzter“, „Simulant“, „Regress“, „Quotient“, aber auch „Miss Wou“ oder „Killer“. Sieht man sich als Beispiel die Siegerliste des ältesten deutschen Klassikers, nämlich der Diana, an, findet man selbst dort Namen wie etwa „Night Petticoat“, Siegerin 1996, oder „Migräne“, die 1894 gewann. „Ausflucht“ (1933) und „Zwietracht“ (1873) stehen „Eintracht“ (1889), „Herzdame“ (1888), „Einsicht“ (1912) und „Hochzeit“ (1907) sowie „Vergissmeinnicht“ (1873) gegenüber.
Sozial reichte das Gefälle von „Salve Regina“ (2002) über „Lehnsherrin“ (1934) und „Highness Lady“ (1990) oder „Contessa Pilade“ (1943) zu „Landmädel“ (1937), „Ordonnanz“ (1900) und „Waschfrau“ (1895).
„Närrin“ hieß die Diana-Gewinnerin von 1887, sie war eine der zahlreichen Siegerinnen aus dem Königlichen Hauptgestüt Graditz. „Lustige“ gewann 1955 die Diana und das Derby und besonders originell war der Name der Siegerin von 1899: „Hut ab“. Dagegen wirken Namen wie „Glocke“ (1883) und „Adresse“ (1916) geradezu profan. Einige Stutenköniginnen hatten Namen von erbaulichen Orten wie „Santa Cruz“ (1960) oder „Schönbrunn“ (1969).
Zahlreiche der bisher 149 Siegernamen stammen aus der Tier- und Pflanzenwelt, etwa „Libelle“ (1872), „Forelle“ (1892) und „Orchidee“ (1913). Das wohl Naheliegendste, nämlich Frauennamen, kommt in der Siegerliste besonders häufig vor und so wimmelt es dort besonders in den frühen Jahren neben verwegenen Kreationen auch von Namen wie Antonia, Margarethe, Gudrun, Ilse oder Lore.
Darüber, dass die Grenzen des guten Geschmacks bei der Namensvergabe nicht allzu weit überschritten werden, wachen die Mitarbeiter der Gestütbuchabteilung im Direktorium für Vollblutzucht und Rennen. Sie verhinderten zum Beispiel die Rennlaufbahn einer „Panzerfaust“ und achten auch auf die Persönlichkeitsrechte lebender oder sogar verstorbener Individuen.
Aus solchen Gründen wurde in Frankreich vor Jahren dem Besitzer des Spitzengaloppers „Talleyrand“ per Gerichtsbeschluss aufgegeben, den Hengst umzutaufen. Eine Nachfahrin des berühmten Staatsmanns dieses Namens hatte Anstoß daran genommen, dass da ein Ross mit dem Namen ihres Ahnherrn herumlief.
Die Witwe des Ballettstars Waclaw Nijinski hatte dagegen keine Einwände, als der Name „Nijinski“ an einen Vollblüter verliehen wurde. Ihr Mann hatte vor seinem Tode geäußert, er werde dermal einst wiederkehren als ein schönes wildes Pferd. Der nach ihm benannte Hengst wurde dann eines der besten Pferde der Vollblutgeschichte.
Manche große Züchter haben ihr eigenes System für die Namensgebung entwickelt. Im Gestüt Fährhof, dessen Gründer Walther J. Jacobs das gleichnamige Kaffee-Imperium aufgebaut hatte, hält man sich bis heute gerne an Ortsnamen aus Kaffeeanbaugebieten. Davon zeugen auch die Diana-Siegerinnen „Longa“ (1992), „Comprida“ (1986), „Padang“ (1985) und „Leticia“ (1980). Das Gestüt Ravensberg bevorzugt bis heute Namen aus der Waidmannssprache und gewann die Diana 1954 mit „Wildbahn“. Oder das Derby mit „Waidwerk“ und „Wilderer“.
Der Name einer Stute ließ die Rennbahnsprecher in England jahrelang schier verzweifeln: Sie hieß „She sells sea shells“. Einen solchen Namen würde man bei uns mit Rücksicht auf die armen Rennkommentatoren vielleicht nicht genehmigen, aber es gab auch in Deutschland schon ziemlich unaussprechliche Namen, etwa zum Beispiel „Iwnwseb“. So hieß ein Pferd vor dem Ersten Weltkrieg. Die Rennbahnbesucher nannten es aber lieber „das Loreleypferd“, denn damit kamen sie besser zurecht und außerdem hatten sie erfahren, was Iwnwseb bedeutete: Es waren die aneinandergereihten Anfangsbuchstaben der Loreley-Zeile: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.“